STRAFRECHT ALS (UN-)GEIGNETES MITTEL ZUR BEKÄMPFUNG VON WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT?
Prof. Dr. jur. Ralph Westerhoff Dipl.Kfm.
Stellungnahme zu dem Beitrag von Dr. Rainer Ohler, Fünf Jahre Dieselgate im Strafprozess – was lernen wir daraus
Vor drei Wochen veröffentlichte unser Partner Dr. Rainer Ohler einen kontroversen Beitrag zur Leistungsfähigkeit des Strafrechts bei der Verhinderung von Wirtschaftskriminalität. Hier falle Deutschlang im europäischen Vergleich zurück. Ralph Westerhoff, Professor für Wirtschafts- und Arbeitsrecht an der Hochschule Koblenz, setzt sich in seiner Replik kritisch mit den Thesen Ohlers auseinander. Das Strafverfahren gegen den Einzelnen wegen seines Fehlverhaltens, so Westerhoff, sei ein ungeeignetes Instrument, um die strukturellen Defizite, die zur Wirtschaftskriminalität führten, zu beseitigen. Er meldet praktische und verfassungsrechtliche Bedenken an. Ein mögliches Unternehmensstrafrecht sieht er ebenfalls als kritisch an.
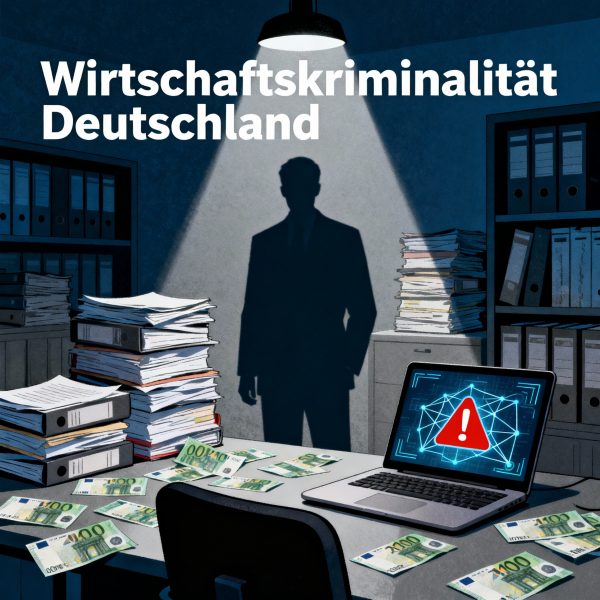
Ob nun „Diesel-Gate“, „Cum-Ex“ oder „Wirecard“, um nur die prominentesten Fälle zu erwähnen: eines ist in solchen Fällen immer gewiss und allen gemein. Sie offenbaren ein strukturelles Versagen von Kontrollmechanismen in Institutionen. Manche Individuen nutzen dies dann aus, um sich oder Dritten (wozu auch (wie im Falle von beispielsweise VW) das eigene Unternehmen zählen kann), rechtswidrige Vermögensvorteile zu verschaffen.
Dies ist kein nationales Phänomen, sondern kommt überall vor und betrifft bei multinational tätigen Unternehmen viele Länder und damit (potenziell) viele Rechtsordnungen. Ein Teilaspekt solcher Fälle ist dann die nationale Aufarbeitung der (straf)rechtlichen Verantwortung handelnder Personen.
Rainer Ohler widmet sich in seinem Beitrag diesem komplexen Phänomen und stellt Überlegungen dazu an, wie erstens derartige Fälle schneller aufgearbeitet, die verantwortlichen Personen und Institutionen effektiver pönalisiert und drittens die offensichtlich fehleranfälligen Strukturen der betroffenen Unternehmen aufgebrochen und erneuert werden können.
Die Kernaussagen seines Aufsatzes sind cum grano salis folgende Thesen:
- Die rein nationale Aufarbeitung internationaler Wirtschaftskriminalität sei ineffektiv. Es bedürfe daher supranationaler Behörden, die effektiv in solchen Fällen tätig werden können, wie dies z.B. in den USA der Fall sei.
- Die Sanktionen in derartigen Fällen müssten schnell und hart erfolgen, damit dadurch das beschädigte öffentliche Vertrauen sowie der Rechtsfrieden wiederhergestellt werden würde.
- Das nationale Strafrecht sei zur Verfolgung (internationaler) Wirtschaftskriminalität ungeeignet. Es sei langsam und zeitige unbefriedigende Ergebnisse (Ohler zitiert hier beispielsweise die Einschätzung des Ergebnisses im Falle Rupert Stadtler (Audi) als „Pyrrhussieg“).
- Neben der individuellen Verantwortung müssten auch die Organisationen in die Pflicht genommen und insbesondere auch Gegenstand strafrechtlicher Normen werden.
So sehr ich das Ziel teile, so sehr habe ich Zweifel an der Geeignetheit, ja teilweise Verfassungsmäßigkeit der von Ohler vorgeschlagenen Maßnahmen.
Beginnen möchte ich meine Replik mit einer grundsätzlichen Betrachtung der Funktion des Strafrechts. Das Strafrecht als „schärfstes Schwert“ staatlicher Sanktionsmöglichkeiten knüpft am sozialschädlichen Verhalten eines Individuums an. Das Strafverfahren dient dann der Feststellung eben jener individueller Schuld, die wiederum ihrerseits Grundlage der vom Gericht zu bemessenden Strafe ist.
Aus guten Gründen kommen die Worte „effektiv“, „schnell“ und „Genugtuung“ in dieser Kurzbeschreibung nicht vor. Auch ist eine Bestrafung des Angeklagten allenfalls das Ergebnis, nicht aber das primäre Ziel eines Strafverfahrens. Insofern greift die Vokabel „Pyrrhussieg der Justiz“ beispielsweise im Stadtler-Prozess zu kurz oder ist sogar falsch: Die Verurteilung des Delinquenten ist kein Sieg der Justiz, weil diese nicht gegen den Angeklagten kämpft.
Natürlich ist die „Wiederherstellung des Rechtsfriedens“ (oder, weniger höflich, das Rachebedürfnis des Volkes) ein Reflex des Urteils, nicht aber seine Rechtfertigung. Wäre dem anders, dürfte es beispielsweise in so manchen Missbrauchsfällen nichts anderes als „lebenslänglich“ geben (und wenn man ehrlich ist, würde die kochende Volksseele oft noch weit mehr fordern).
Das Strafverfahren gegen den Einzelnen wegen seines Fehlverhaltens ist daher ein ungeeignetes Instrument, um die strukturellen Defizite, die zur Wirtschaftskriminalität in und durch Unternehmen geführt haben, aufzuarbeiten und bestenfalls zu beseitigen.
Man könnte nun auf den Gedanken kommen, stattdessen „das Unternehmen“ zu bestrafen. In diese Richtung zielt der von Ohler favorisierte Gedanke der „Verbandssanktion“. Ich habe ganz grundlegende Bedenken. Unternehmen sind (wie Staaten) juristische Personen. Als solche sind sie zwar mögliche Träger von Rechten und Pflichten, wahrgenommen werden diese aber durch die jeweiligen Organe. Wenn diese Fehler in Ausübung ihrer Organtätigkeit begehen, ist die juristische zwar finanziell, nicht jedoch strafrechtlich haftbar. Diese verbleibt bei den handelnden Menschen. Es kann (nach meiner Überzeugung) nämlich keine „Verbandsschuld“ geben. Da aber die individuelle Schuld Grund und Maßstab des Strafrechts sind, lehne ich eine Strafbarkeit der juristischen Person ab.
Was also bleibt, ist das öffentliche Recht. Wenn man so will, geht es um ein Gewerberecht, das denn Herausforderungen international tätiger Unternehmen gerecht wird. Ob das Deutsche Recht insoweit ausreichend ist, möchte ich bewusst offenlassen. Ich warne aber davor, aus Effektivitätsüberlegungen („schnell und hart“) internationale Behörden zu schaffen, denen Eingriffsmöglichkeiten eröffnet werden, die nicht einer ggfs. ebenso effektiven gerichtlichen Überprüfung unterworfen sind.
Die Erfahrung lehrt nämlich, dass der Staat, der Eingriffsmöglichkeiten hat, die bis und über die Zulässigkeitsgrenze ge- und missbraucht und deshalb durch die dritte Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes in die Schranken gewiesen werden muss. Diesen Aspekt des potenziellen Missbrauchs und seiner Verhinderung vermisse ich bei den Ausführungen Ohlers an der einen oder anderen Stelle.
Zusammenfassend teile ich die Analyse Ohlers, dass die Wirtschaftskriminalität internationaler und komplexer geworden ist. Ich halte allerdings das (nationale) Strafrecht für ausreichend, die individuelle Schuld der handelnden Personen festzustellen und zu sanktionieren. Es ist definitionsgemäß ungeeignet, strukturelle Defizite in Unternehmen zu beseitigen. Es dient auch nicht primär dem öffentlichen Sanktionsbedürfnis. Ein Unternehmensstrafrecht kann es mangels Straffähigkeit einer juristischen Person nicht geben.
Ob das geltende öffentliche Gewerberecht ausreicht (und in der Vergangenheit nur nicht hinreichend eingesetzt wurde), habe ich nicht geprüft. Ich warne aber davor, vorschnell neue Eingriffsmöglichkeiten zu schaffen, die vom Staat nämlich auch missbraucht werden können.
Dieser Text stellt eine Replik auf eines der Strategic Intervention Papers (SIP) dar, das Dr. Rainer Ohler für das Global Ideas Center in Berlin verfasst habe. Die vollständige Version des Papers finden Sie hier:Deutschland und Wirtschaftskriminalität – Global Ideas Center
Sieber Advisors unterstützt Unternehmen und Einzelpersonen dabei, ihre Krisenkommunikation und ihre Litigation-PR so aufzustellen, dass sie dauerhaft ihre Reputation schützen und Prozessziele erfolgreich erreichen können.